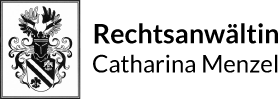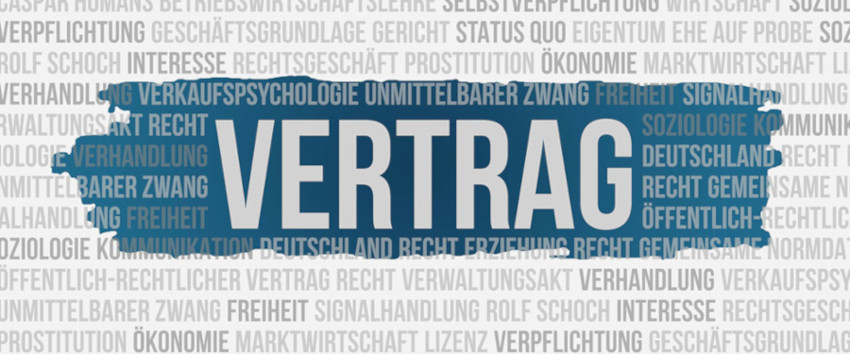Kaufverträge zählen zu den häufigsten Verträgen, denen wir im Alltag begegnen – vom Onlineshopping bis zum Kauf eines Autos oder einer Immobilie. Als erfahrene Anwältin für Vertragsrecht informiert Rechtsanwältin Catharina Menzel Sie hier kurz und verständlich zu allem, was Sie zu Ihren Rechten rund um den Kaufvertrag wissen sollten.
Grundlagen des Kaufvertragsrechts
Der Kaufvertrag ist rechtlich im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Gemäß § 433 BGB ist für einen Kaufvertrag maßgeblich, dass er eine schuldrechtliche Einigung über die Ware, die gekauft wird, sowie den dafür zu zahlenden Preis enthält. Darüber hinaus enthalten viele Kaufverträge noch Vereinbarungen zum Leistungsort, zur Fälligkeit des Kaufpreises, zur Zahlungsweise oder weiteren Details. Als typischer gegenseitiger Vertrag enthält er eine gegenseitige Verpflichtung, den Kaufpreis für die Ware zu zahlen beziehungsweise die Ware für den Kaufpreis zu übergeben. Der Kaufvertrag kommt zustande, indem ein Angebot durch den Käufer oder die Käuferin angenommen wird. Dann bilden diese beiden Willenserklärungen ein Rechtsgeschäft.
Typisch für den Kaufvertrag ist, dass die Kaufsache mit Geld bezahlt wird – anders als bei Tausch- oder Schenkungsverträgen. Als Kauf würde aber beispielsweise auch eine privatrechtliche Versteigerung zählen. Zu den Dingen, die man kaufen kann, zählen dabei nicht nur Sachen, sondern auch Rechte. Sogar Waren, die sich gar nicht im Eigentum des Verkäufers oder der Verkäuferin befinden, sondern erst noch beschafft werden müssen, können verkauft werden. Muss der Verkäufer oder die Verkäuferin die Ware erst noch herstellen und liefern, wird ein Werklieferungsvertrag, ein Sonderfall des Kaufvertrags, geschlossen. Die Preisgestaltung schränken, mit Ausnahme etwa des Buchhandels, wo Preisbindungen existieren, nur die Grenzen der Sittenwidrigkeit ein.
Ein weiterer wichtiger Punkt im Kaufvertragsrecht ist die Fälligkeit des Kaufpreises. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind die sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Verpflichtungen gleichzeitig fällig – vergleichbar mit einem Ladengeschäft, in dem man an der Kasse bezahlt und mehr oder weniger gleichzeitig, oder Zug um Zug, die bezahlten Waren erhält. Es sind aber auch andere Vereinbarungen, darunter beispielsweise Ratenzahlung, möglich. Mit Ausnahme von bestimmten Käufen, wie dem Erwerb einer Immobilie, einer Erbschaft oder eines GmbH-Anteils, für die eine notarielle Beurkundung nötig ist, werden Kaufverträge formfrei geschlossen. Dabei können Kaufverträge auch mündlich geschlossen werden, etwa beim Einkaufen in einem Laden.
Eine Besonderheit im als B2C- oder Endkundengeschäft bezeichneten Bereich, also bei Kaufverträgen, bei denen Privatpersonen die Endkunden sind, ist der besondere Schutz für private Verbraucher. Mit der seit Januar 2022 gültigen Warenkauf-Richtlinie werden beispielsweise der Sachmangelbegriff sowie der Kauf digitaler Waren und Rechte rund um die Gewährleistung im Sinne der privaten Käufer und Käuferinnen neu geregelt.
Typische Probleme im Kaufvertragsrecht
Ob mit oder ohne „böse Absichten“: Nicht immer entspricht die erhaltene Ware den Vorstellungen, die man als Käufer oder Käuferin bei der Annahme des Angebots und des dafür zu zahlenden Kaufpreises hatte. So kommt es immer wieder vor, dass ein gekaufter Gebrauchtwagen plötzlich nicht mehr anspringt oder ein im Online-Shop gekauftes Produkt nicht der Beschreibung oder dem erwarteten Zustand entspricht oder gar nicht erst geliefert wird. Ein übliches Problem ist auch, dass bestellte Waren verspätet oder gar nicht ankommen und der Verkäufer oder die Verkäuferin eventuell sogar Anfragen ignoriert. Hier einige typische Beispiele aus dem Alltag:
- Ein Kunde oder eine Kundin hat einen Neuwagen von einem Autohändler gekauft. Schnell stellt sich aber heraus, dass der elektrische Fensterheber hinten links nicht funktioniert.
- Ein im Internet gekaufter Fernseher, der laut Angaben im Onlineshop „innerhalb von 2 bis 3 Werktagen“ geliefert werden sollte, ist nach einer Woche immer noch nicht versendet worden.
- Ein Smartphone entspricht nicht den im Onlineshop beworbenen technischen Spezifikationen.
- Ein in einem Online-Versandhaus bestellter schwarzer Kleiderschrank wurde in Weiß geliefert.
- Ein als „Zustand neu“ in einem Onlineshop verkauftes Smartphone zeigt deutliche Gebrauchsspuren.
Welche Rechte Sie in solchen Fällen haben und wozu Sie selbst dabei verpflichtet sind, hängt maßgeblich von den Details ab. Grundsätzlich müssen Sie zunächst den Verkäufer oder die Verkäuferin über den Mangel informieren und können Nacherfüllung verlangen. Manchmal ist die Lage aber etwas komplexer, zudem haben Sie etwa bei einem defekten Neuwagen viel Geld investiert und entsprechend viel zu verlieren. In solchen Fällen ist es ratsam, sich kompetenten rechtlichen Beistand zu suchen. Gerne berate ich Sie zu Ihrem konkreten Problem und unterstütze Sie dabei, Ihr Recht durchzusetzen – sowie auch bei weiteren rechtlichen Problemen rund um Verträge, wie Arbeitsverträge oder Aufhebungsverträge.
Ihre Rechte und Pflichten laut BGB
Ist die erhaltene Ware mangelhaft, können sich Käufer und Käuferinnen auf ihre Sachmangelrechte nach den Regelungen des § 437 BGB berufen, sollten aber auch die besonderen Bestimmungen in den AGB des Verkäufers oder der Verkäuferin prüfen. Zudem ist dabei zu beachten, dass die Sachmangelrechte hintereinander in einer bestimmten Reihenfolge abgestuft sind und nacheinander einzufordern sind:
- Anspruch auf Nacherfüllung: Käufer haben Anspruch darauf, dass beispielsweise ein defektes Gerät gegen ein funktionierendes Gerät ausgetauscht oder repariert wird.
- Rücktrittsrecht: Ist kein Austausch möglich, etwa weil es das letzte Exemplar oder ein Einzelstück war, schlägt die Reparatur fehl oder verweigert der Verkäufer oder die Verkäuferin die Nacherfüllung gänzlich, kann der Käufer bzw. die Käuferin vom Kaufvertrag zurücktreten und das Geld zurückerhalten.
- Minderungsrecht: Statt vom Kaufvertrag zurückzutreten, kann der Käufer oder die Käuferin auch den Kaufpreis im Verhältnis des Warenwertes mit dem Mangel zum Warenwert ohne Mangel mindern.
- Anspruch auf Schadenersatz: Verweigert der Verkäufer bzw. die Verkäuferin die vorherigen Verlangen des Käufers oder der Käuferin, so dass der Mangel beispielsweise selbst durch Reparatur in einer Werkstatt behoben werden muss, kann der Käufer oder die Käuferin Schadenersatz für die hierfür anfallenden Kosten verlangen.
Dabei ist es wichtig, die Kaufsache direkt nach Erhalt auf Mängel zu prüfen und diese zu dokumentieren. Die Gewährleistungsansprüche können zudem nach § 438 BGB verjähren. Bei den meisten alltäglich gekauften und verkauften Waren beträgt diese Verjährungsfrist zwei Jahre.
Aber wie ist ein Sachmangel überhaupt definiert? Die rechtliche Grundlage hierfür bildet § 434 BGB. Dort werden mit der neuen Warenkauf-Richtlinie nun drei Kategorien unterschieden:
- Subjektive Anforderungen: Diese beinhalten die vereinbarte Beschaffenheit, die Eignung für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung und die Vollständigkeit des vereinbarten Lieferumfangs, etwa mit dem vereinbarten Zubehör oder vereinbarten Anleitungen.
- Objektive Anforderungen: Diese beinhalten die Eignung der gekauften Sache für deren gewöhnliche Verwendung und die Sache muss Äußerungen zu Spezifikationen etc. in der Werbung oder auf dem Etikett entsprechen und mit dem zu erwartenden Zubehör geliefert werden.
- Montageanforderungen: Insofern die Montage durch den Verkäufer oder die Verkäuferin unsachgemäß oder nach der beiliegenden fehlerhaften Anleitung selbst falsch durchgeführt wurde, sind die Montageanforderungen nicht erfüllt und es handelt sich dann ebenfalls um einen Sachmangel.
Ob die betreffenden Mängel dem Käufer oder der Käuferin vor dem Kauf bekannt sind, ist seit dieser Gesetzesänderung für private Verbraucher und Verbraucherinnen nicht mehr relevant. Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs, das meint bei privaten Käufen üblicherweise den Zeitpunkt, an dem der Käufer oder die Käuferin die Ware erhält, nicht allen oben genannten Anforderungen entspricht. Wichtig ist auch zu wissen, dass gemäß § 477 BGB eine Beweislastumkehr gilt. Das bedeutet, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin innerhalb des ersten Jahres die Mangelhaftigkeit beim Erhalt der Ware nicht beweisen muss.
Auch der Lieferzeitpunkt oder ein Zeitrahmen für die Lieferung kann Teil des Kaufvertrags sein. Dieser ist aber nur verbindlich, wenn dies auch so formuliert ist. Ein Beispiel wäre „garantierte Lieferung“ bis zu einem bestimmten Termin. Dann hat sich der Verkäufer bzw. die Verkäuferin verpflichtet, zu diesem Termin zu liefern, und ist im Verzug, wenn der Termin überschritten wird. Wird ein unbestimmter formulierter Lieferzeitraum wie „2–3 Werktage“ genannt und überschritten, dann muss der Käufer bzw. die Käuferin gemäß gesetzlicher Vorschriften zunächst eine realistisch erfüllbare Frist zur Nacherfüllung setzen. Dies sollte schriftlich erfolgen, um es später nachweisen zu können. Erst damit wird der Verkäufer bzw. die Verkäuferin in Verzug gesetzt. Sollte weiterhin keine Ware eintreffen, können Sie vom Vertrag zurücktreten und Ihr Geld zurückverlangen.
Nicht zuletzt ist zu beachten, dass private Verkäufer und Verkäuferinnen mit Formulierungen wie „Die Ware wird von privat unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft“ die Haftung ausschließen können. Für arglistig verschwiegene Mängel kann die Haftung aber dennoch weiterbestehen. Auch hier ist daher juristisch kompetente Unterstützung bei vielen Streitigkeiten, etwa nach dem Kauf eines Gebrauchtwagens von einer Privatperson, sinnvoll.
Unterstützung bei Vertragsstreitigkeiten durch einen Anwalt
Viele Händler zeigen sich bei Sachmängeln oder Lieferverzögerungen kooperativ und tragen aktiv dazu bei, den Mangel zu beheben, oder bieten selbst Entschädigungen für verspätete Lieferungen an. Dies ist allerdings leider nicht immer der Fall. Darüber hinaus ist es nicht immer ganz einfach, Ihre Rechte als Käufer oder Käuferin selbst zu überblicken. Im oben genannten Beispiel des defekten Fensterhebers stellt sich etwa die Frage, ob Sie hier eine Reparatur oder einen Austausch des gesamten Fahrzeugs einfordern können und welche Schadenersatzansprüche für Sie aus der daraus resultierenden Verzögerung erwachsen.
Gerne prüfe ich im Streitfall Ihren Kaufvertrag und bespreche mit Ihnen die konkreten Möglichkeiten für das weitere Vorgehen. Hierfür kommuniziere ich in Ihrem Namen mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin und fordere Ihre Rechte ein. Führt dies nicht zum Erfolg, etwa bei betrügerischen Verkäufern, folgen rechtliche Schritte, bei denen ich Sie ebenfalls kompetent vertrete. Zögern Sie nicht, meine Kanzlei in München zu kontaktieren – gemeinsam finden wir eine Lösung für Ihre Probleme rund um gekaufte oder bestellte Waren.
FAQ
Woran erkenne ich, ob mein Fall Erfolgschancen hat?
Liegen Sachmängel, wie eine Abweichung von der vereinbarten oder marktüblichen Beschaffenheit, vor, ergeben sich aus dem Kaufvertrag entsprechende Rechte für den Käufer oder die Käuferin. Darüber hinaus entscheiden über den Erfolg aber auch weitere Details. Erstens muss beim Einfordern der Rechte eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden. Zweitens sind die Erfolgschancen bei seriösen Unternehmen aus dem Inland oder der EU höher als bei unseriösen Verkäufern, die möglicherweise den Kontakt verweigern. Kompetente Unterstützung durch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin verbessert gerade bei komplizierteren Fällen die Erfolgschancen und ist besonders bei Problemen mit teureren Waren, wie Autos, empfehlenswert.
Wie hilft ein Anwalt bzw. eine Anwältin konkret bei Vertragsproblemen?
Ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin schaut sich den Kaufvertrag und die Begleitumstände genau an, außerdem ist er oder sie mit den rechtlichen Bedingungen vertraut. So kann er oder sie genau einschätzen, welche Rechte Sie in Ihrer konkreten Situation haben und Sie dabei unterstützen, diese Rechte außergerichtlich sowie, wenn nötig, gerichtlich durchzusetzen. Hierzu zählt auch die Kommunikation mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin.
Was kostet anwaltliche Hilfe – und wer zahlt das?
Die Kosten für anwaltlichen Beistand sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RAV) geregelt und richten sich nach dem Streitwert. Wird beispielsweise ein Sofa mit einem Wert von 1000,- € reklamiert und der Verkäufer bzw. die Verkäuferin verweigert die Nacherfüllung, so dass ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin eingeschaltet werden muss, entstünden eine Geschäftsgebühr in Höhe von 120,90 € sowie 20 € Aufwandspauschale, jeweils zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer. Hat der Verkäufer bzw. die Verkäuferin die Nacherfüllungsfrist verstreichen lassen, muss er bzw. sie auch den Verzugsschaden, inklusive der entstandenen Anwaltskosten, begleichen. Dies gilt allerdings nicht, wenn sich die Reklamation als unbegründet erweist. Auch die Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten dafür, einen Rechtsanwalt oder -anwältin zu beauftragen, hier ist aber je nach Tarif eine Selbstbeteiligung möglich.
Wie schnell kann ich Unterstützung bekommen?
Da Ihre Ansprüche aus einem Kaufvertrag auch verjähren können, sollten Sie die Lösung solcher Probleme nicht auf die lange Bank schieben. Kontaktieren Sie meine Kanzlei gerne umgehend für den nächsten freien Beratungstermin.
Wann kann ich vom Vertrag zurücktreten oder Geld zurückverlangen?
In der Regel steht an erster Stelle die Nacherfüllung, also beispielsweise der Austausch defekter Produkte. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie vom Vertrag zurücktreten und Ihr für die Kaufsache gezahltes Geld zurückverlangen. Bei nicht gelieferter Ware können Sie ebenfalls vom Vertrag zurücktreten. Hierfür müssen Sie allerdings dem Verkäufer oder der Verkäuferin zunächst schriftlich eine realistisch erfüllbare Nachfrist setzen. Reagiert er oder sie nicht auf Ihre Forderungen oder Ihren schriftlichen Rücktritt vom Vertrag, ist Unterstützung durch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin unbedingt zu empfehlen.
Gibt es eine kostenlose Ersteinschätzung?
Es gibt das Angebot der Erstberatung bei einem Rechtsanwalt, das nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) mit höchstens 180 € zzgl. Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden darf. Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung ohne Selbstbeteiligung abgeschlossen haben, entstehen Ihnen für das Hinzuziehen eines Rechtsanwalts zu Ihrem Gewährleistungsfall keine Kosten.
Übernimmt meine Rechtsschutzversicherung die Kosten?
Rechtsschutzversicherungen übernehmen die Kosten für Rechtsstreitigkeiten rund um Kaufverträge. Ob Ihre Versicherung hier greift und wie hoch Ihre Selbstbeteiligung gegebenenfalls ist, können Sie den Details Ihres gewählten Tarifs entnehmen.